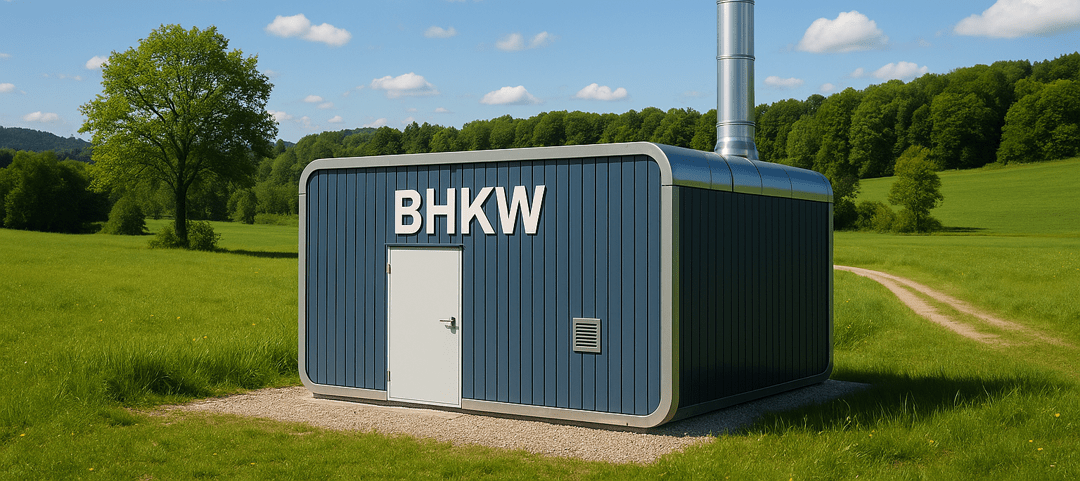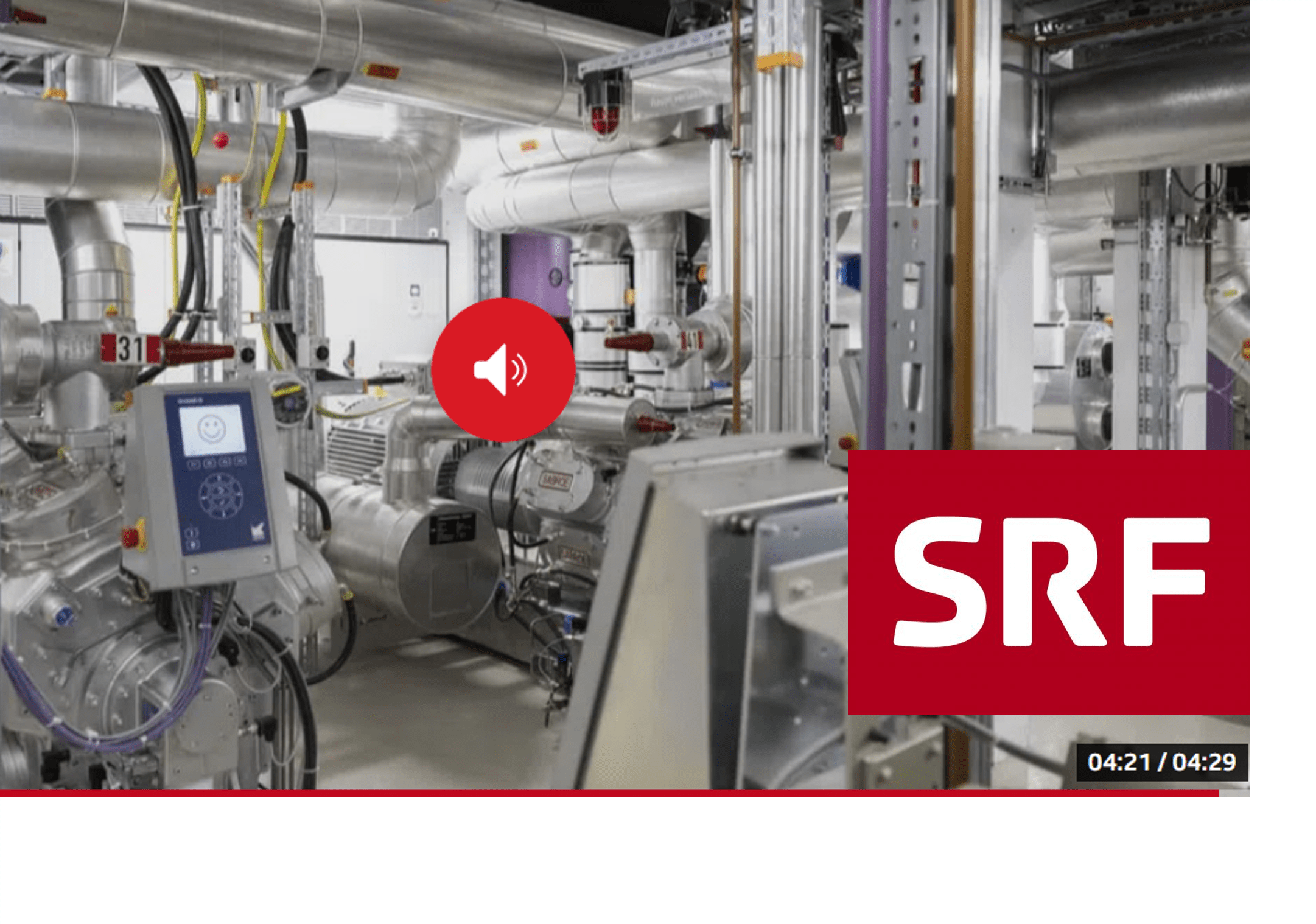Der Wasserkraft-Ausbau des Bundes gerät ins Stocken: Viele Projekte werden verkleinert oder gar nicht umgesetzt. Es droht der Wegfall von rund 2 TWh zusätzlichem Winterstrom – genau so viel, wie mit WKK-Anlagen im Hintergrund von Wärmenetzen in den nächsten drei Jahren realisiert werden könnte.
Der Ausbau der Wasserkraft sollte eine tragende Rolle spielen, um den Atomausstieg und die Klimaziele der Schweiz zu erreichen. Bis 2040 wollte der Bund mit 16 Projekten rund zwei Terawattstunden zusätzlichen Winterstrom gewinnen. Diese Vereinbarung hatten Bundesrat, Energieproduzenten, Wasserkraft-Verbände und Umweltorganisationen vor vier Jahren an einem runden Tisch getroffen. Nun zeigt sich jedoch: Das Ziel ist in weite Ferne gerückt: Das Bundesamt für Energie rechnet derzeit nur noch mit der Hälfte dieser Menge.
Gründe, warum der Ausbau ins Stocken geraten ist, gibt es verschiedene: Einsprachen, die zu Verzögerungen führen, die Heimfallthematik, also Gemeinden, welche die Staumauern selbst übernehmen, wenn die Konzession ausläuft oder mangelnde Rentabilität der Projekte werden aufgeführt. Weil die bisherigen 16 Wasserkraftprojekte nicht wie geplant vorankommen, will der Bundesrat nun prüfen, ob weitere Vorhaben auf die Liste der bevorzugten Projekte mit übergeordnetem nationalem Interesse gesetzt werden sollen.
Ein möglicher Ausweg liegt in der Realisierung von WKK-Anlagen. Wie in der sogenannten Rytec-Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie aufgezeigt werden konnte, könnte durch die Realisierung von WKK-Anlagen im Hintergrund von Wärmenetzen – nur durch einen Teilersatz bestehender fossiler Spitzenlastkessel – genau die wegfallende Menge bereitgestellt werden. Der grosse Vorteil: die Anlagen können einfach bestellt und in Betrieb genommen werden, was in den nächsten drei Jahren realisiert werden könnte.
Weitere Informationen: